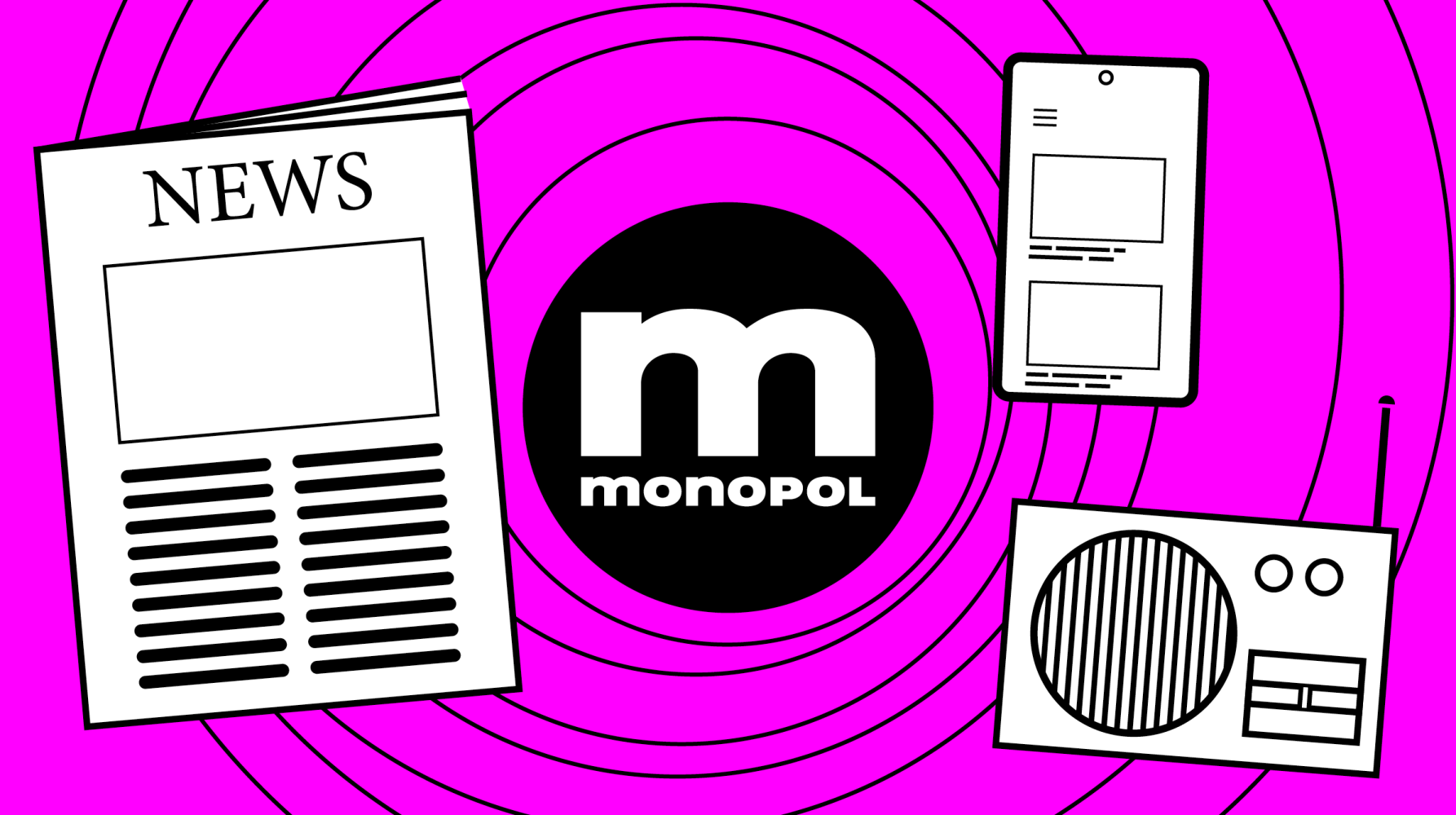Debatte
Viele Kulturschaffende in und aus Georgien haben Angst, dass das Land ein russischer Satellitenstaat werden könnte. So hat die dortige Regierung Anfang Juni das Gesetz gegen "ausländische Einflussnahme" in Kraft gesetzt – trotz massiver Proteste. Viele Kulturorganisationen sind jedoch von Förderung aus dem Ausland abhängig - und fürchten nun einen Zusammenbruch der Zivilgesellschaft. Die Schriftstellerin Nino Haratischwili fordert im Interview mit dem "Standard" deshalb einen Kulturboykott. "Jeder muss sich im Rahmen seiner Mittel aktiv gegen den russischen Einfluss stellen, und ein klares 'Nein' signalisieren – ob auf der Straße, in der Kunst oder in den Medien. Es muss nun alles boykottiert werden, was mit dem georgischen Staat im Zusammenhang steht. Das machen Kulturschaffende bereits, zum Beispiel das Schriftstellerhaus und das National Film Center in Tbilisi. Fast alle professionellen Kulturschaffenden, Regisseure sowie bekannte Autor:innen nehmen nicht mehr an staatlichen Literaturwettbewerben oder Kulturfestivals teil. Schriftsteller:innen weigern sich, das Land auf der Frankfurter Buchmesse zu repräsentieren. Ich schließe mich diesem Boykott an: Er demaskiert die Regierung, die dadurch an Autorität verliert."
Kunstmarkt
In der "SZ" kann man einen Essay von Peter Richter über die Allgegenwart von Tattoos im Allgemeinen und über Tattoos als Kunsteditionen im Besonderen lesen. Zunächst konstatiert Richter, dass man sich heute irgendwie nackt fühle, wenn man untätowiert baden gehe. Kunst am Körper ist nichts außergewöhnliches mehr, es kommt nur darauf an, erklärt der Autor, ob Trägerin oder Träger zum Kunstbetrieb zähle oder nicht. Richter stellt die Frage, "ob sich auf dem Gebiet der Tätowierungen schlicht noch einmal vollzieht, was in der Kunstgeschichte ein Jahrhundert zuvor geschehen ist. Nämlich die Verabschiedung von mimetischer Könnerschaft aus dem Kreis dessen, was seit der Moderne zur Kunst im engeren Sinne gezählt wird (…) Ein wie gedruckt auf die Wade übertragenes Babyfoto mag ein hohes technisches Prestige haben, aber kein besonders hohes kulturelles. Die Sternchen und Blümchen auf den Ärmchen des Kunstbetriebsnachwuchses unter seinen grob gehauenen Ponyfrisuren haben dagegen die Aura der Hieroglyphen-Bilder eines A.R. Penck". Bei "Ratlosigkeit vor dem leeren Stück Haut" hilft jedenfalls Holm Friebe von der Zentralen Intelligenz-Agentur, der das Unternehmen "Works on Skin" gegründet hat, die Tattoos von Kunstschaffenden vermittelt (die man sich im Zweifel aber auch nur an die Wand hängen kann). "Die Künstlerliste hat es in sich", jauchzt Richter, "junge Berliner Stars wie Olga Hohmann und Charlie Stein neben Altmeistern wie Gregor Hildebrandt, Martin Eder und, sozusagen als Doyen der Ganzkörper-Totalkunst, sogar Timm Ulrichs, der sich Anfang der Siebziger schon das Wort 'The' aufs eine Augenlid tätowieren ließ und aufs andere das Wort 'End'". Auch Laura Ewert schreibt in ihrer "Freitag"-Kolumne "Kunsttagebuch" über das Projekt: "Dabei könnte festgestellt werden, dass Works on Skin auch als Kommentar zu Besitz und Besessenheit zu lesen ist. Sollte Kunst überhaupt verkauft werden und wie? Wie ernst meint man es mit ihr, wenn man sie sich nicht auf die Haut tackert? Es ist jedenfalls eine sehr schöne Schnapsidee, die hilft, den ganzen Kunstquatsch nicht ernster zu nehmen als ein Tattoo."
Museen
Dirk Peitz findet es in der "Zeit" lustig, dass in der Caspar-David-Friedrich-Schau in der Alten Nationalgalerie Berlin, die gestern zu Ende gegangen ist, so viele Menschen vor den Bildern standen, vor Gemälden, die doch von der Einsamkeit handeln. "Womöglich ist die Friedrich-Begeisterung nämlich bloß das, was man einen Hype nennt. Bei einem solchen speist sich die Massenbegeisterung aus der Massenbegeisterung selbst: Wenn alle hinwollen, will man auch hin. Aber Halt, man möchte sich nicht über andere Kunstbegeisterte erheben. Sie werden ihre guten Gründe haben. Und wären die nicht so zahlreich da am Freitagabend, wäre man also ganz allein den Gemälden Friedrichs ausgesetzt, da würde man es tatsächlich mit der Angst zu tun kriegen: vor der Einsamkeit in den Bildern. Die Einsamkeit würde man womöglich in sich selbst finden, oder wenigstens könnte sie in einen hinein kriechen. Das möchte man doch auch nicht! Dann lieber gemeinsam einsam sein und die Einsamkeit so vergessen. Und sei es um den Preis, kaum zu sehen, wovor man sich fürchtet: letztlich vor sich selbst."
Ausstellung
"Die reinste Lust und Freude an schwarzen Lebenswelten" findet Philipp Meier für die "NZZ" in der Ausstellung "When We See Us" im Kunstmuseum Basel, die Malerei aus Afrika und der afrikanischen Diaspora zeigt. Besonders hebt er hervor, dass die dort gezeigten Werke Klischees der Schwarzen Kultur umschiffen - kommt aber nicht umhin, sie alle von Jazz bis Rap noch einmal zu nennen. Auch politisch attestiert Meier der Schau wohltuende Abwesenheit von Dogmatismus. "Dieser schillernd-panoptische Blick auf Malerei von schwarzen Kunstschaffenden – ein Highlight unter den europäischen Kunstausstellungen dieses Sommers – hat gegenüber anderen vergleichbaren Ausstellungen vor allem einen Vorzug: Er ist nicht eine weitere Manifestation westlicher Selbstanklage im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung. Die jetzige Basler Schau ist auch keine 'I am Black and Blue'-Demonstration schwarzer Künstler. 'My only sin is in my skin', sang in diesem Song Louis Armstrong noch vor fast hundert Jahren. 'Say it loud – I am black and I am proud', intonierte dagegen James Brown gut fünfzig Jahre später. Und genau mit diesem Klang kommen die Gemälde in der Ausstellung herüber. Sie zelebrieren Stolz auf die eigene Kultur und die reinste Lust und Freude am Alltag panafrikanischer Lebenswelten rund um den Globus."
Im "Tagesspiegel" schreibt Alexandra Wach über die Retrospektive "Lucia Moholy: Exposure" in der Kunsthalle Prag, für die Kritikerin "ein weiterer, fälliger Schritt auf dem Weg zu ihrer Anerkennung als Virtuosin der Fotografie des 20. Jahrhunderts". Moholy sei der Spagat gelungen, Gebrauchsobjekte zu dokumentieren und gleichzeitig den Geist einer Zeit zu konservieren. Nach dem Krieg wurden viele ihrer Bilder ohne Quellenangabe reproduziert, ein Vakuum, dem die Schau mit einer Auswahl neu entdeckter Glasplatten begegnet, und die Ausstellung "kombiniert den von einer Lichtdramaturgie profitierenden Parcours mit Installationen des zeitgenössischen tschechischen Künstlers Jan Tichy, der in einen spannenden Dialog mit dem Werk tritt", so Wach.