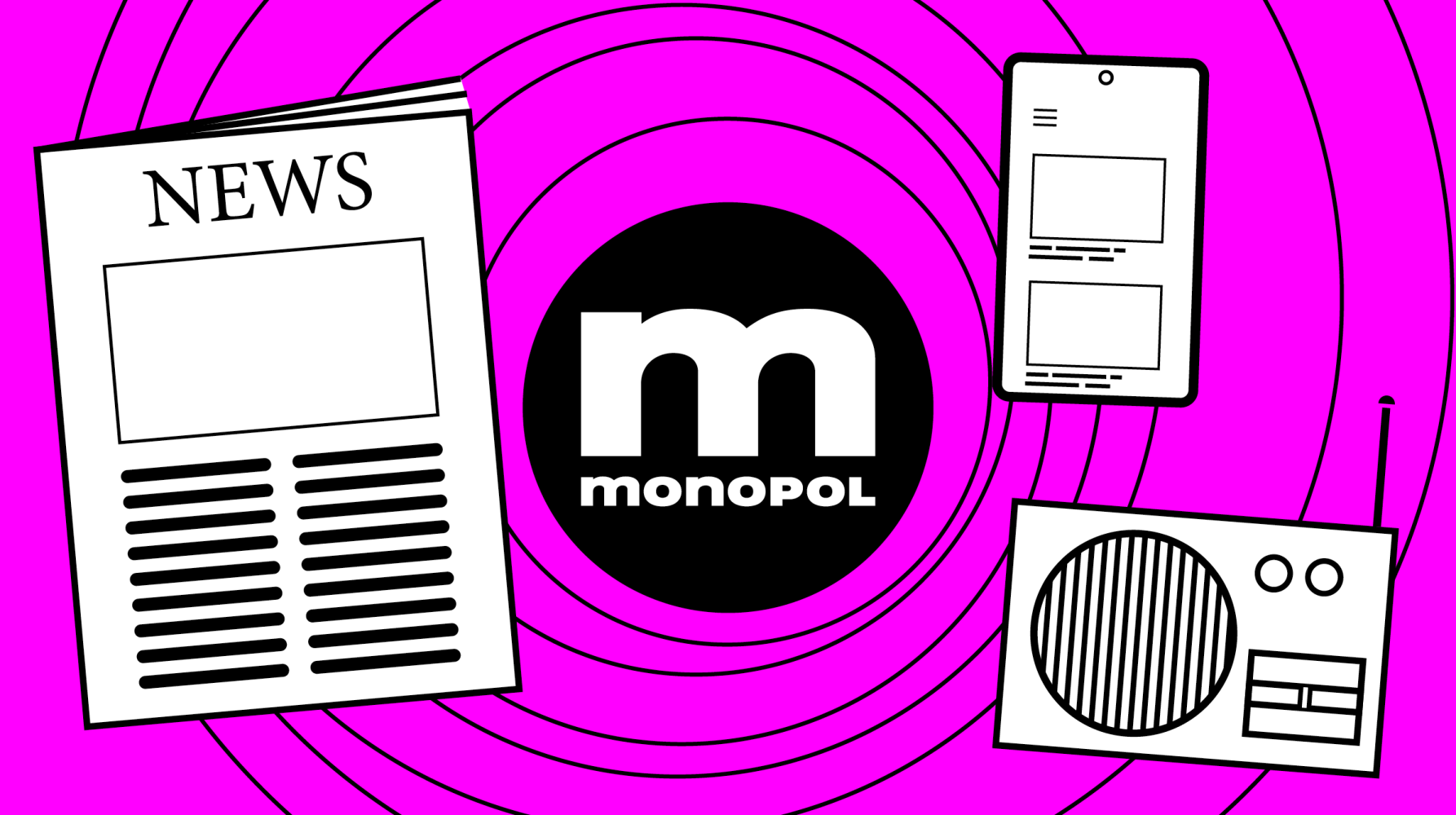Debatte
Drei Wochen nach seinem Oscar-Gewinn für "No Other Land" wurde der palästinensische Regisseur Hamdan Ballal im Westjordanland von radikalen jüdischen Siedlern zusammengeschlagen und dann festgenommen. Inzwischen ist er wieder frei. Quynh Trần berichtet in der "Zeit", dass sich die Oscar Academy zum Zeitpunkt des Schreibens ihres Textes noch nicht zu dem Angriff geäußert habe. "Die Academy of Motion Pictures, die den wichtigsten Filmpreis der Welt verleiht, hat zu dem mutmaßlichen Angriff auf Ballal bisher kein Statement abgegeben, im Gegensatz zu vielen anderen Filmorganisationen, wie Yuval Abraham beim Kurznachrichtendienst X schrieb. Der Co-Regisseur von 'No Other Land' berichtete, dass die Academy dazu 'keine Notwendigkeit' gesehen hätte. Da bei dem Vorfall neben Ballal auch andere Palästinenser angegriffen worden seien, bestehe kein Zusammenhang mit dem prämierten Film. Auch zu diesen Vorwürfen hat sich die Academy bisher nicht geäußert." Der Dokumentarfilm "No Other Land" ist auch Thema in der "NZZ", allerdings aus einem anderen Grund. Autor Andreas Scheiner sieht einen "kopflosen Aktivismus" in der Kunst am Werk, bei dem sich "linke Palästina-Freunde" genauso lächerlich machten wie "rechte Anti-Wokeisten". Als Beispiel nennt er die Kritik der Boykottbewegung BDS am israelisch-palästinensischen Projekt "No Other Land", das extrem israelkritisch sei, aber nun trotzdem aus der eigenen Blase angegriffen werde. "Die antiisraelische Boykottbewegung BDS verurteilt das Werk. Wenn es nach der tonangebenden Anti-Israel-Fraktion geht, gehört 'No Other Land' offenbar verboten. Weg mit Palästinas Oscar-Triumph. Als Grund gibt BDS unter anderem an, dass israelische Mitglieder der Filmequipe ihre Abneigung gegen Israel zu wenig vehement bekundet hätten. 'They have failed to acknowledge that Israel is perpetrating a genocide.' Sie haben vergessen, 'Genozid' zu sagen." Scheiner behauptet, dass der einst gerechtfertigte Kampf gegen Diskriminierung sich nun selbst kannibalisiere. "Einer Minderheit anzugehören, ist heute das günstigste Eintrittsticket für die Kunstwelt. Wie aber zeigt man, dass man marginalisiert ist? Man zeigt zunächst einmal sich selbst. Deshalb produziert der moderne Künstler kaum mehr Kunst. Er produziert sich. So ist er zum Aktivisten geworden. Und als Aktivist muss er sich behaupten gegen andere Marginalisierte, die auch Zutritt zum Klub wollen. Der Boykottaufruf ist die Allzweckwaffe. Wobei der Boykotteur im Bestreben, jemanden zu boykottieren, eher früher als später bei seinen Nächsten landet. Das ist die Natur des Boykottwesens. Die linke Kulturszene hat vorgemacht, wo das Ganze hinführt. Doch gleichzeitig hat nun der Wind gedreht. Der Weltgeist hat die Konterrevolution des Donald Trump gebracht."
Gratulation
In der "FAZ" würdigt Christian Geyer die Philosophin und Leiterin des Einstein Forums in Potsdam, Susan Neiman, die heute 70 wird - und die sich "ihre moralische Klarheit im Sozialen nicht von den Unterhändlern der Wokeness abhandeln" lasse, wie Geyer schreibt. Auch in die Diskussionen um Kunstfreiheit und den Umgang mit der anti-israelischen Boykottbewegung BDS hat sie sich immer wieder eingeschaltet. Sie sei inzwischen eine "linke Bastion in rechtspopulistischen Fluten", so der "FAZ"-Redakteur, und wer "wie Neiman das Böse für eine Kategorie mit Erklärungskraft hält (ihr Hauptwerk 'Das Böse denken. Eine andere Geschichte der Philosophie' zeugt davon), ist gegen Scheinobjektivitäten gefeit. 'Warum erwachsen werden?' – ihr schönstes Buch ist eine hinreißende Ermutigung, dem Leben trotz seiner Aufgeschmissenheit einen Sinn abzuringen", freut sich der Gratulant.
Film
Heute startet der Spielfilm "Mond" in den Kinos, in dem die Performancekünstlerin Florentina Holzinger eine Privattrainerin spielt, die nach Jordanien geht und dort ihren drei Schülerinnen bei der Flucht aus dem patriarchalen Elternhaus helfen will. Für den "Tagesspiegel" haben sich Andreas Busche und Moritz Honert mit der kurdisch-österreichischen Regisseurin Kurdwin Ayub unterhalten. Nicht nur der Islam, jede Religion sei "ein Käfig", erzählt die Filmemacherin. "Ich habe aber den Eindruck, dass der Islam immer stärker wird. Nicht nur im arabischen Raum, zum Beispiel im kurdischen Teil des Irak, wo meine Familie herkommt. Auch hier in Europa. Nicht stärker im Sinne von Terror, sondern in dem Sinne, dass sich Leute in die Religion zurückziehen. Meine ganze Verwandtschaft wird immer muslimischer", sagt Ayub. Ihre Arbeiten kreisen um das Bild, das der Westen vom Islam und dem Nahen Osten hat, so bezieht sich Ayubs aktuelle Volksbühnen-Produktion "Weiße Witwe", die im Jahr 2666 im Islamischen Staat Europa spielt, der von einer sexbesessenen Diktatorin beherrscht wird, auf eine Nordirin, die zum Islam konvertierte und heute eine gesuchte Terroristin ist. "Mich faszinieren diese Leute mit ihren romantischen Vorstellungen vom Islam oder von der arabischen Kultur im Allgemeinen", erklärt die Regisseurin im Interview. "Vielleicht steckt da auch bloß eine Sehnsucht drin. Die arabische Familie ist ja wärmer und enger, als man das in Europa kennt. Das kann durchaus negative Seiten haben, ich muss zum Beispiel mindestens alle drei Tage mit meiner Familie telefonieren, sonst ist die beleidigt. Vielleicht sehnen sich andere Menschen genau danach." Die Monopol-Review zu "Mond" lesen Sie hier.
Museen
Das Wallraff-Richartz-Museum in Köln zeigt gerade ein Gemälde, bei dem es sich eventuell um eine Van-Gogh-Fälschung handelt. In einer Ausstellung mit Leihgaben aus der Schweiz ist die Autorenschaft des Werks mit einem Fragezeichen markiert. Für Stefan Koldehoff in der "Zeit" ist diese Lösung symptomatisch: "Das Kölner Museum folgt mit dieser Entscheidung einer Entwicklung, die sich schon seit mehreren Jahren feststellen lässt: Kunstwerke werden nicht mehr allein als kulturelle, sondern auch als historische Objekte wahrgenommen. Sie stehen nicht mehr allein für eine ästhetische Ideengeschichte, sondern werden immer häufiger auch als Gegenstände der Zeitgeschichte präsentiert." Koldehoff folgert: "Museen sind dadurch nicht mehr der Olymp unumstößlicher Wahrheiten, sondern – viel glaubhafter – Orte, an denen wissenschaftlich nach diesen Wahrheiten gesucht wird. Und an denen man auch transparent damit umgeht, wenn sich lange geglaubte Gewissheiten als falsch herausstellen."
Das besondere Kunstwerk
Sie haben es wieder getan. Nach ihrer DAF-Coverversion vor vier Jahren stellten Johathan Meese und DJ Hell ihre Hommage an die Gruppe Kraftwerk in Wien vor. Diesmal ist auch Mutter Brigitte Meese dabei, berichtet Peter Richter in der "Süddeutschen Zeitung". Man könne "hinter all dem, was die Meeses hier vorführen, immer auch das dramatische deutsche Riesenkrisenthema von der Pflege durchhören. Jonathan Meese redet davon, dass er jetzt mit Leidenschaft zurückgebe, was er selbst als Baby an Fürsorge erfahren habe", schreibt Richter, und das könne "als Anwendungsfall des Meese’schen Kunstbegriffs gelten. Denn der lautet, Kunst sei Liebe, und was mit Liebe gemacht wird, sei Kunst, 'egal, ob man Bilder malt oder einen Bus fährt'", wie der Autor Meese zitiert. Das mit der Single bereits verfügbare Video (das Album "Gesamtklärwerk Deutschland" erscheint am 11. April) bedeute "viereinhalb Minuten hellen Wahnsinns", so Richter: "Zwei Roboter mit stark verjüngten Antlitzen von Meese und Hell auf der Autobahn, im Transeuropaexpress, auf Rennrädern und dergleichen Kraftwerk-Reverenzen mehr; dann Mutter Meese als Bond-Bösewicht, drollige Horror-Erdmännchen, irre Morphing-Effekte, Abgang durch die Kanalisation, ein heroinabhängig aussehender Jesus weint Milch, schließlich Weltraumfahrt und Sternenstaub."