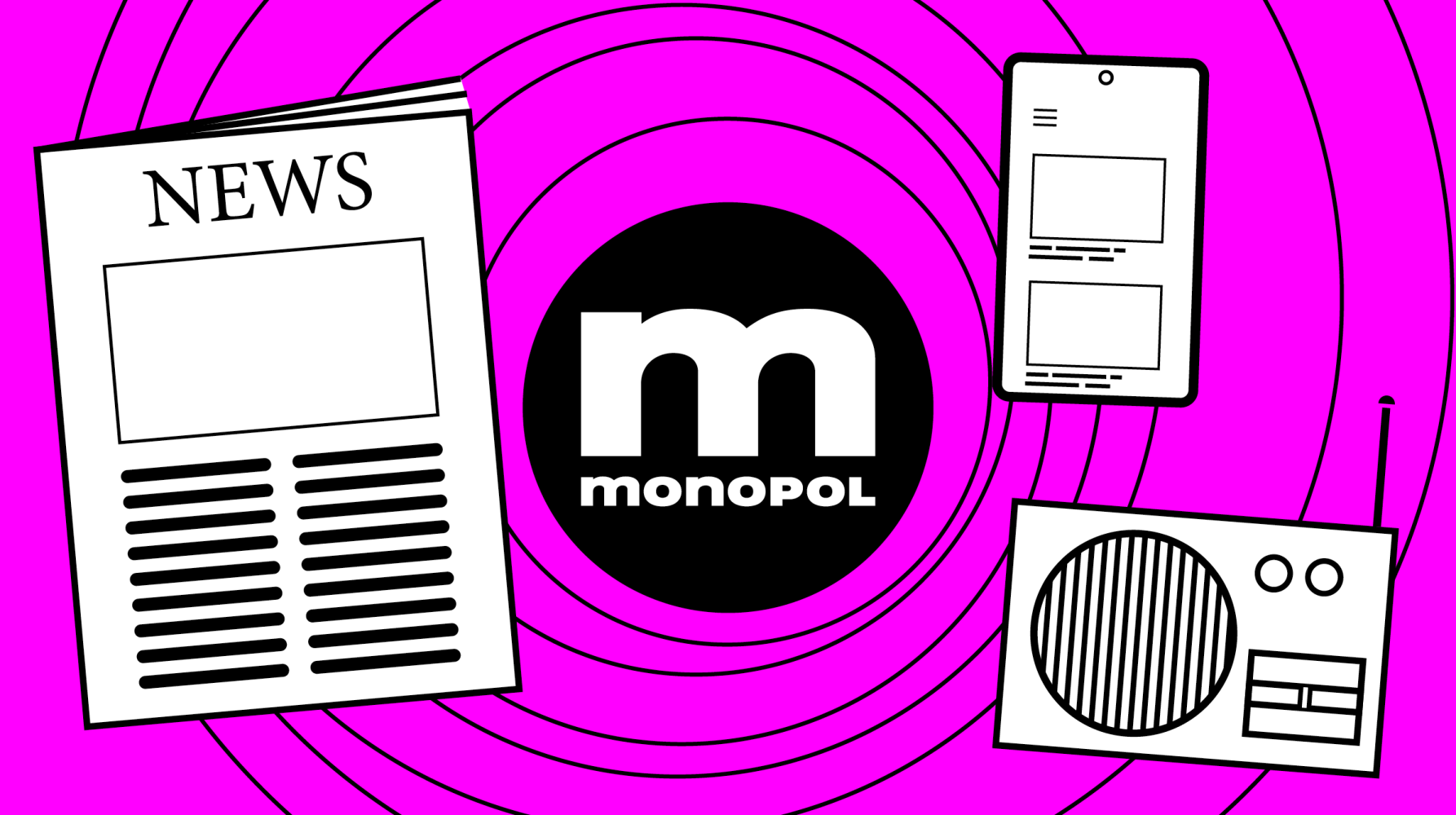Fotografie
Nachdem Vertreter indigener Völker dem brasilianischen Fotograf Sebastião Salgado im "Guardian" vorwarfen, dass seine Porträts von Amazonas-Bewohner exotisierend und sexualisiert seien (siehe Medienschau vom 20. Januar), verteidigt nun ein Sprecher einer indigenen Gemeinschaft den Brasilianer in einem Leserbrief: "Diese Bilder sind von zentraler Bedeutung für die brasilianische Kultur und, was noch wichtiger ist, sie dienen dazu, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Notwendigkeit der Erhaltung des Regenwaldes zu lenken, ohne den diese Gemeinschaften nicht überleben können. Salgado war sich bewusst, dass er in die Tiefen des Amazonas vordringen musste, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zu ziehen. Er fotografierte Gebiete, zu denen nur die brasilianische Regierung über ihre Nationale Stiftung für indigene Völker Zugang gewähren kann. Salgado arbeitet aktiv mit unseren Organisationen zusammen und fotografiert nur Gruppen, die ihn dazu eingeladen und ermächtigt haben." Der Sprecher bezeugt auch Salgados politischen Einfluss auf den Obersten Gerichtshof Brasiliens, der dafür sorgte, dass indigene Gruppen medizinisch versorgt wurden, "als sie von der Regierung Bolsonaro während der Covid-19-Pandemie im Stich gelassen wurden. Dies führte zu dem als ADPF-709 bekannten Rechtsinstrument, das für viele dieser Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung war, einschließlich derjenigen, die sich in freiwilliger Isolation befinden und kürzlich kontaktiert wurden."
Elf Tage nach US-Präsident Donald Trump wurde nun auch das offizielle Porträt von Melania Trump veröffentlicht. "Der Spiegel" ist natürlich sofort wieder mit einer Bildanalyse zur Stelle. "Ihr Foto spinnt seines fort", schreibt Ulrike Knöfel. "Zusammen betrachtet, sozusagen als Doppelbildnis, ergeben die Ehepartner die moderne Version von Bonnie und Clyde. Donald Trump hat immerhin ein Polizeifoto nachgestellt, will absichtlich wie ein Gangster wirken. Melania Trump wiederum zitiert mit ihrem Auftritt 'House of Cards', also jene Netflix-Erfolgsserie über das Weiße Haus, in der sich die zentralen Figuren mit ihren oft mörderischen Intrigen zu überbieten versuchen. Keiner kann da keinem vertrauen, und am Ende hat die weibliche Hauptfigur die Präsidentschaft ergattert."
Kunstmarkt
Eine regelrechte Schwemme an Kunstwerken sieht Magnus Resch auf dem Kunstmarkt zukommen, wie er in "Art News" analysiert: "Der Markt stützt sich seit langem auf einen schrumpfenden Pool von Käufern, um sein oberes Ende zu erreichen, und diese Herausforderungen werden durch einen beispiellosen Generationentransfer von Vermögenswerten noch verschärft. In den nächsten 25 Jahren werden schätzungsweise 73 Billionen Dollar von den Babyboomern auf die Generation X, die Millennials und die Generation Z übergehen. Ein Teil davon wird in bedeutenden Kunstsammlungen gebunden sein, doch fehlt den Erben oft das emotionale oder finanzielle Engagement für diese Werke, sodass etwa 50 Prozent der geerbten Sammlungen verkauft werden." Warum sollte man also dennoch weiter Kunst kaufen, wenn durch das zu erwartende Überangebot ein Wertverlust zu erwarten ist? Weil Kunst nicht einfach nur eine Investition sei, schreibt Resch. "Kunst bietet etwas viel Tiefgründigeres: die Möglichkeit, Kreativität zu fördern, ein kulturelles Erbe aufzubauen und sich mit einer Gemeinschaft gleichgesinnter Mäzene zu engagieren. Ich nenne das verantwortungsbewusstes Kaufen, und es macht die Transaktion zu einem philanthropischen Akt. Wenn ich ein Stück kaufe, denke ich nicht an den Wiederverkaufswert. Vielmehr unterstütze ich die Künstlerin und ermögliche ihr, weiter zu schaffen. Dadurch werden wiederum die Galerien und Künstlergemeinschaften unterstützt, die das Lebenselixier der Kultur sind. Kunstsammeln ist für mich eine Art, Gutes zu tun, die mit einer greifbaren Belohnung einhergeht: ein Objekt, das ich liebe, eine Geschichte, die ich erzählen kann, und eine Verbindung zu einer größeren Geschichte."
Museen
Die "Mona Lisa" soll im Pariser Louvre einen eigenen neuen Saal erhalten, kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag an. Das am meisten frequentierte Museum der Welt solle außerdem einen neuen Eingang bekommen, um die Besucherströme besser zu bewältigen. Jonathan Jones findet das im "Guardian" hochnäsig. "Die von Emmanuel Macron auf dramatische Weise verkündete Entscheidung, die 'Mona Lisa' in eine spezielle, hygienisch isolierte Galerie zu verlegen, wo die Idioten, die in Scharen vor der Mona Lisa Selfies machen, die kultivierteren Besucher, die die Kunst in einer ruhigen Atmosphäre studieren wollen, nicht stören, ist ein unangebrachter Akt des Snobismus. Er könnte das Ökosystem des Louvre als Ort, an dem hohe Kunst zur Populärkultur wird, ruinieren."
Der britische Schauspieler Stephen Fry (67) hat sich im Athener Akropolis-Museum für die Rückgabe der Elgin Marbles eingesetzt - jener Friesteile des Parthenon-Tempels auf der Akropolis, die im British Museum ausgestellt sind. Um die wertvollen Altertümer schwelt seit Jahrzehnten ein Streit zwischen Athen und London. Er liebe sein Land, sagte Fry, er liebe Shakespeare, Dickens und die Beatles, aber hinsichtlich der Elgin Marbles schäme er sich, wird er unter anderem von der griechischen Zeitung "Kathimerini" zitiert. "Die alten Griechen hatten die Idee, dass man Dinge ändern und besser machen kann", sagte Fry. Dazu gebe es auch heute die Gelegenheit, indem die Friesteile zurück nach Athen kehrten. Griechenland könne stattdessen andere Artefakte nach London schicken - eine Win-win-Situation. Das Akropolis-Museum sei das beste Museum der Welt, es gebe keine Ausrede, die Friesteile dort nicht hinzuschicken. "Wir müssen den Gordischen Knoten zerschlagen." Der britische Diplomat Lord Elgin hatte Anfang des 19. Jahrhunderts die am besten erhaltenen Marmorplatten und -skulpturen des Frieses abbauen und nach England bringen lassen. Dort verkaufte er sie 1816 an das Britische Museum. Elgin habe die Friesteile legal erworben, heißt es aus London; Athen dementiert das und fordert die Rückgabe. Für die Rückkehr der Altertümer hat Stephen Fry in seinem Kopf schon das Drehbuch geschrieben. Er stelle sich vor, wie ein Schiff die Elgin Marbles auf demselben Weg zurückbringe, den sie einst nach Großbritannien nahmen, sagte er. Wie die Menschen an den Ufern stünden und jubelten und wie die wertvolle Fracht schließlich in Athen eintreffe. "Ich bin sicher, auch der König wäre anwesend", sagte Fry über König Charles III. Die Rückkehr hätte auch internationale Relevanz, glaubt Fry: "Die ganze Welt würde lächeln."
Podcast
Der Soziologe Heinz Bude, Gründungsdirektor des Documenta-Instituts in Kassel, spricht im "Zeit"-Podcast "Und was machst du am Wochenende?" über seine katholische Kindheit in Wuppertal in der Schreinerei seiner Eltern, seine Jugend in der West-Berliner Hausbesetzerszene, seine Besuche in Prenzlauer Berg Mitte der 1980er-Jahre und von seiner Leidenschaft für Fußball.